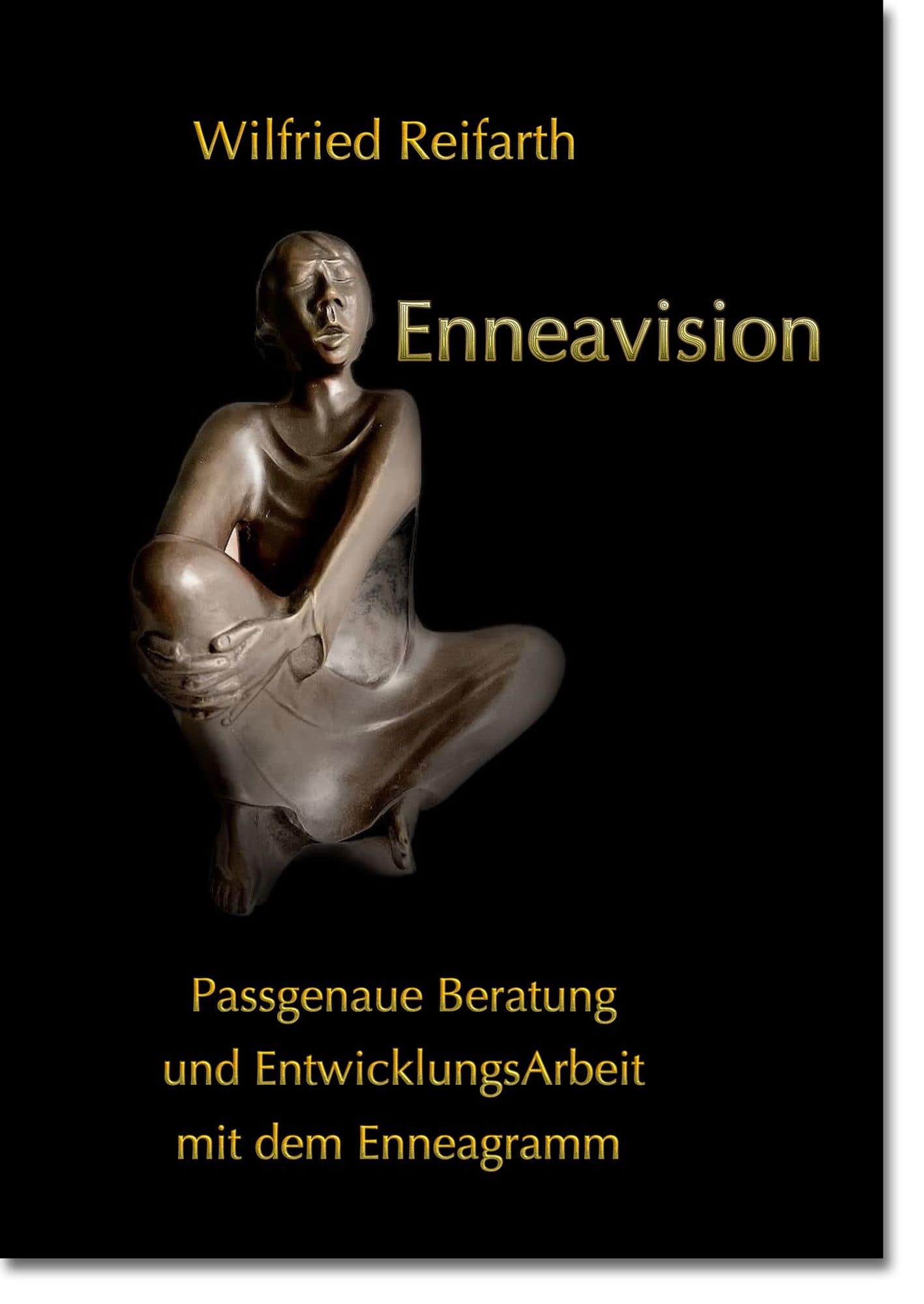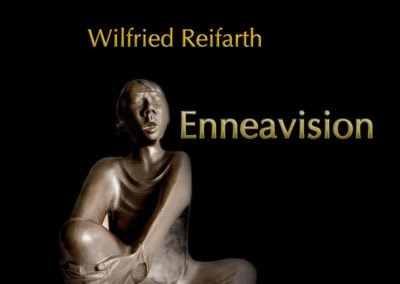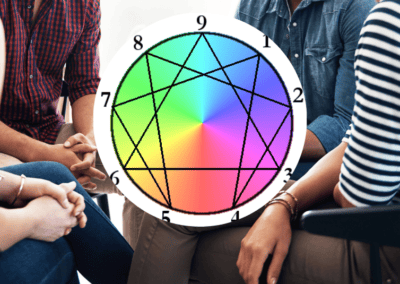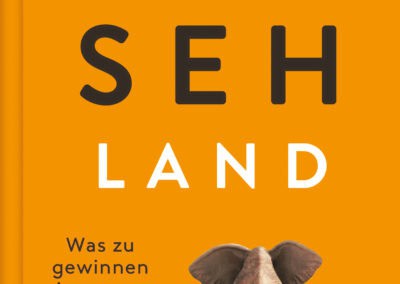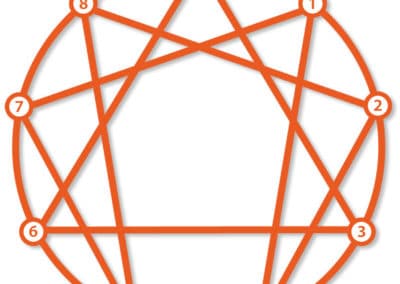Enneavision – Bericht aus einem zweijährigen Entwicklungslabor
In seinem neuen Buch berichtet Wilfried Reifarth über ein zweijähriges Experiment, das 30 von ihm ausgebildete Enneagrammlehrerinnen und -lehrer unternommen haben, moderiert von ihm und seiner Partnerin Barbara Stiels. Die Leitfrage dazu lautete: Wie müsste eine Beratungsphilosophie beschaffen sein, die der neunfach unterschiedlichen „Anderheit“ von uns Menschen gerecht wird und sie dadurch tatsächlich „erreicht“? Damit ist klar, was mit dem Titel «Enneavision» des Buchs gemeint ist, das hier vorgestellt wird: eine Form der Beratung («Supervision»), die das Enneagramm konsequent integriert, so der Untertitel des Buchs:Passgenaue Beratung und EntwicklungsArbeit mit dem Enneagramm. In diesem seinem sechsten Buch zum Enneagramm ist jedoch nicht Wilfried Reifarth der Autor, sondern alle 32 Beteiligten im O-Ton ihrer neun Enneatypen, die in den wortgetreu transkribierten Protokollen der vielen Treffen an insgesamt 18 Seminartagen zu Wort kommen. Um dieses „Entwicklungslabor Enneavision“ und das Buch richtig einzuordnen ist hilfreich, einige Merkmale und Spezialitäten von Wilfried Reifarth und seinem DEZ (Deutsches Enneagramm Zentrum) zu kennen:
- Reifarths Enneagrammarbeit ist aus Weiterbildungsangeboten für Menschen in sozialen und pädagogischen Berufen entstanden. Die Teilnehmenden an seinen Seminaren sind Menschen, die schon in ihrer beruflichen Grundausbildung gelernt haben, sich selber zu reflektieren und in gruppendynamischen Prozessen zu interagieren.
- Seine Enneagrammarbeit findet in der Regel in plenaren Gruppenprozessen zu bestimmten Fragestellungen statt, zu denen sich unter seiner Moderation die neun Enneagrammtypen (von ihm -muster genannt) einbringen und aufeinander eingehen.
- Dieser Lehr- und Lernprozess mit dem Enneagramm in offenen Großgruppenprozessen entfaltet ein Zusammenwirken, welches er im Unterschied zur üblichen Psycho- und Gruppendynamik als «Enneadynamik» bezeichnet. Dazu gehört, immer wieder Phasen einzuschalten, in denen diese Prozesse auf einer Metaebene gemeinsam reflektiert werden.
- Eine zentrale Rolle neben dem Enneagramm spielt für Wilfried Reifarth Martin Buber: seine Dialogphilosophie («Alles wirkliche Leben ist Begegnung») passe kongenial zum Enneagramm, diesem «Wahren Modell lebendiger Prozesse». Besonders in diesem Projekt (und auch in diesem Buch) legt er Wert darauf, dass die Teilnehmenden nicht in einem «Ich-Es-Modus» miteinander kommunizieren, sondern in einem dialogischen «Ich-Du-Beziehungsmodus», d.h. in einer Haltung, die sich die eigene Wirkung auf seine Gegenüber und deren Resonanz auf sich vor Augen hält.
- Konflikte und Störungen haben nicht nur in der üblichen Gruppendynamik, sondern auch in Reifarths Enneadynamik Vorrang: Sobald solche auftauchen, werden diese achtsam aufgearbeitet, bis wieder eine hinreichende Arbeitsfähigkeit am Thema erreicht ist, und der unterbrochene Prozess fortgeführt werden kann.
- In diesen Lernprozessen sind auch «Muster-Zweifel» willkommen: Wenn jemand den eigenen oder den Enneatyp von jemandem in der Gruppe in Frage stellt, ist dies kein Tabubruch, sondern eine willkommene Gelegenheit, die in Frage kommenden Enneatypen gemeinsam näher zu betrachten, der betroffenen Person zu einer grösseren Klarheit ihrer Zugehörigkeit im Enneagramm zu verhelfen – gegebenenfalls auch zu tieferen Einsichten. Sie sind immer ein Anlass, gemeinsam das Enneagramm tiefer zu verstehen.
Sehnsuchtsorte und Entwicklungsziele der neun Enneatypen als erste Orientierungspunkte
Nun zum Buch konkret: Das «Entwicklungslabor Enneavision» begann im Februar 2020 mit einem viertägigen Prozess und der damals noch ahnungshaften Frage, ob die konsequente Anwendung der Enneagramm-Idee neue Möglichkeiten für helfende Beziehungen eröffnet: für pädagogische, andere agogische, beratende und auch Leitungssituationen in sozialen Berufsfeldern.
Im Ersten Teil (S. 9 – 54) sind die Grundlage und dieser 4-tägige Start beschrieben. Was als Neuland betreten wurde, bekam in diesen Tagen erste Konturen: Um der Integrität des Andern – seinem Sosein – wirklich gerecht zu werden, stiess die Gruppe als erstes auf die Frage, welche Sehnsuchtsorte die neun Muster kennen (aufgelistet S. 36), und welche Entwicklungsziele sie sich für ihren eigenen Enneatyp wünschen, die von Beratungspersonen zu beachten wären. Darauf gestossen, war die Gruppe anhand der drei ersten Typenmuster, die in den Fokus genommen wurden: einer SIEBEN, einer NEUN, einer EINS.
Die Fortsetzung dieses Anfangs geriet allerdings anders als geplant: Im Frühjahr 2020 kam jäh die Corona-Situation dazwischen – und die neun Folgetreffen fanden schliesslich als online Videokonferenzen statt. Niemand hat dieser Form im Vorfeld Kredit gegeben: ob nicht die ganze Subtilität lebendiger Gruppenprozesse flöten ginge, war die Befürchtung. Acht Monate nach dem ersten Treffen, wurde zu einem ersten Versuch online eingeladen. Und siehe da: An Subtilität ging nicht viel verloren, am begonnenen Prozess konnte nahtlos angeknüpft werden, und es zeigten sich auch Vorteile: nebst den gesparten Anfahrtswegen zum Beispiel, dass von den Sequenzen Video-Aufzeichnungen gemacht werden konnten, die sich für die Nacharbeit – auch für jeweils Abwesende – wertvoll erwiesen, und auch als Grundlage für ihre Verschriftlichung in diesem Buch dienten. Die Protokolle dieser neun digitalen Seminartage sind im zweiten Teil (S. 55 – 407) so betitelt:
Innenansichten der Ennea-Muster
Fortgeführt wurde der begonnene Prozess mit den Mustern der Enneatypen FÜNF (ausführlich) und VIER, immer wieder unterbrochen von den Prozessen, die bei Einzelnen im Verlauf dieses Labors angestossen und an Folgetreffen aufgegriffen und reflektiert wurden. Diese Exkurse nehmen im Ganzen viel Raum ein, jedoch mit grossem Gewinn, da die «Enneavision» im Verlauf der neun Seminartage gerade mit diesen individuellen Geschichten (und Auseinandersetzungen) immer konkreter Gestalt annimmt, auch für mich als aussenstehender Leser. Nach dem sechsten Seminartag legte Barbara Stiels als Mit-Moderatorin eine schriftliche Zwischenbilanz zur Frage Was ist Enneavision? vor (S. 270-272): Nebst einer Definition für «Enneavision» ist der grösste Teil eine Haltungs- und Ethikanleitung für diese Form der Beratung, abschliessend mit einigen methodischen Hinweisen wie z.B. dem zentralen, der nicht genug erwähnt werden könne: «Enneavisorinnen und Enneavisoren müssen ihr Ennea-Muster und ihre blinden Flecken (gut) kennen.» Eine ausführliche Runde zu diesem Text zeigte, dass für die restlichen Treffen auf dieser Grundlage aufgebaut werden konnte, dies mit den noch fehlenden Mustern von Ennea-DREI, ZWEI, ACHT und SECHS. Interessant ist, dass bei jedem die Diskussion mit der Formulierung der sog. Holy Idea anhand der Originalzitate von Oscar Ichazo begann: Sowohl die Sehnsuchtsorte wie die verschiedenen Entwicklungsziele zeigten sich im Licht der jeweiligen Holy Idea, die diese auf die Muster des eigenen Enneatyps wirft.
Im dritten und letzten Teil des Prozesses kommen schliesslich – in weiteren 5 digitalen Tagesseminaren – noch Enneavisorische Essenzen der Ennea-Muster EINS bis NEUN hinzu. Die Repräsentantinnen und Repräsentanten hatten dafür die Aufgabe, 10–20 zentrale Begriffe für den eigenen Enneatyp zur Diskussion zu bringen, für Nachfragen und Rückmeldungen. Diese Begriffe beinhalten zweierlei: einerseits Punkte, wie sich die neun Ennea-Muster gesehen und wie sie behandelt werden möchten von EnneavisorInnen; andererseits beinhalten sie Gesichtspunkte, mit denen EnneavisorInnen die verschiedenen Enneatypen durchaus auch herausfordern sollen. Eine bei jedem Enneatyp andersartig delikate Gratwanderung, beiden Aspekten in Beratungsprozessen achtsam Aufmerksamkeit zu schenken.
Enneavision – Der Anderheit des Andern begegnen
Auf den letzten Seiten (553-572) ziehen die 32 Teilnehmenden nach diesem «wilden Ritt» (Barbara Stiels) Bilanz. Die SIEBENERIN Lilly – von den Teilnehmenden vernimmt der Leser im Buch zwar ihre Nummer im Enneagramm, jedoch nur ihr Pseudonym – äussert, dem Neunsprachigwerden ein Stück näher gekommen zu sein. Moritz (einer der SECHSER) stellt fest, dass seine Bewertungsmechanismen gegenüber den neun Mustern weniger geworden sind, und dass ihm dies ermöglicht, der Anderheit des Anderen mit mehr Liebe zu begegnen. Und Penelope, die als NEUNERIN im Buch erstaunlich aktiv ist und oft interveniert, stellt fest: Menschen verstehen heisst, ich kann ihnen sozusagen nicht böse sein für das, wie sie sich verhalten, und was sie sagen. Also: Mir gehen dabei die Feinde aus, und ich kann das begründen, warum das so ist. Für mich fast ein schönes Schlusswort, und ich stimme als Rezensent Penelope zu, dass die Offenheit und diese Art und Weise, wie hier die ganze Gruppe verbindlich und achtsam zusammengearbeitet hat, viele Tiefungen in der Kenntnis der neun Enneatypen und ihrer Muster gebracht hat. Im Ganzen ist dieses Buch nicht nur eine eindrückliche enneagrammatische Prozessdokumentation – sondern gleichzeitig auch eine plastische Anwendung der Begegnungsphilosophie Martin Bubers, die im Verlauf dieser friedensstiftenden Pionierarbeit (so Felix, einer der FÜNFER) im Buch immer wieder konkret greifbar wird.
Einige kritische Anmerkungen
So eindrücklich diese Pionierarbeit und ihre Dokumentation in diesem umfangreichen Band ist, kann ich mit einigen kritischen Bemerkungen nicht hinter dem Berg halten:
- In der Einleitung beschreibt Reifarth (wie schon in früheren Büchern) als seinen «wahrscheinlich tiefgreifendsten Perspektivenwechsel» zur traditionellen Auffassung der «Enneagramm-Idee», dass nämlich die Vorherrschende Leidenschaft der Ennea-Muster (Zorn, Stolz, Eitelkeit etc.) die «Quelle unserer Lebenskraft» sei, und deshalb «die Vorstellung, sie überwinden zu wollen (oder zu müssen), ziemlich widersinnig ist.» (S. 13).
Diese Leidenschaften werden im Lauf des Enneavision-Labors an vielen Stellen thematisiert. Immer wieder taucht dabei – im Licht der jeweiligen Holy Idea! – als Sehnsucht und Entwicklungsperspektive auf, freier von ihr zu werden, sie also durchaus auch zu relativieren, weil sie auch als Behinderung (Fixierung) erlebt wird. Es wäre interessant, ob Reifarth aufgrund dieser Erfahrung sein Dogma, die Leidenschaft sei «kein Laster, sondern unsere Begabung» – welche ihn und das DEZ tatsächlich von allen andern Enneagrammschulen des Vierten Weges unterscheidet – nun nicht doch überdenken müsste. - Dass sich Menschen desselben Ennea-Musters in ihrer Erscheinung voneinander unterscheiden, wird nicht mit den unterschiedlichen Subtyp-Varianten des Enneagramms beleuchtet, sondern mit den Linien im Enneagramm erklärt, die eigentlich etwas Anderes, nämlich Entwicklungsdynamiken der einzelnen Enneatypen beschreiben. Reifarth ersetzt diese Sicht: «Stattdessen gehen wir davon aus, dass jeder Mensch mit diesen Linien mit zwei Mustern in direkter Verbindung steht … Wir nennen diese Sichtweise «Rumpf-Arme-Metapher»: der jeweilige Enneatyp ist der Rumpf, die Linien seine zwei Arme. Dies gäbe Beschreibungsmöglichkeiten an die Hand, «die der Subtypen- oder Mustervarianten-Theorie bezüglich ihres Erklärungspotenzial zumindest ebenbürtig sind» (S. 12f). Im Verlauf der Seminartage wird immer dann, wenn RepräsentantInnen desselben Enneatyps unter sich Unterschiede feststellen, dies mit dem Hinweis erklärt, dass sie halt verschiedene Arme an ihrem Rumpf hätten – interessant, aber mit den Subtypen könnten diese Varianten konkreter gefasst werden. Ich wundere mich auch, dass die drei Zentren (Kopfzentrum, Emotionales Zentrum und Körperzentrum), nach denen sich die 3×3 Enneatypen wesentlich voneinander unterscheiden, in diesem Ennealabor kein Thema war, obschon dies ein zentraler Schlüssel wäre, um wesentliche Aspekt der Andersheit der neun Andern zu verstehen, um sich in der Beratung darauf einzustellen, wie unterschiedlich die neun Enneatypen – auch der eigene! – mit den drei Zentren umgehen.
- Was beim Lesen seltsam berührt, sind Wilfrieds abschätzige Bemerkungen zur Psychotherapie und über andere Enneagrammschulen, die immer wieder auftauchen. Psychotherapie ist nicht auf dem Stand geblieben, wie Martin Buber diese in den späten 50er-Jahren des 20. Jh. charakterisiert hat. Dass sie nur in therapeutischen Beziehungen gelingt, die echte «Ich-Du-Beziehungen» im Sinne Bubers sind, ist inzwischen eine Binsenwahrheit; und viele psychotherapeutische Ansätze ziehen die spirituelle Dimension, in welcher es um «die Behandlung des Wesentlichen im Menschen geht», inzwischen sehr wohl ein, und dies auch legitim. Peinlich wirken Wilfrieds Abwertungen anderer Enneagrammschulen, die mehrmals auftauchen: S. 61 glaubt er, dass seines Erachtens «unser Konzept der weltweit erste Versuch darstellt, die Enneagramm-Idee über unsere Ego-Grenzen hinaus einzusetzen, und uns gegenüber der Neunheit zu öffnen.» S. 247 dann, dass es bisher überhaupt keinem Versuch gelungen sei, die Automatismen unserer Muster ausser Kraft zu setzen, «weil niemand in diese Tiefe gedacht hat bisher», während das DEZ sich dahin bewegen würde. (Ich verzichte hier darauf, Enneagrammschulen aufzulisten, die in der Tradition des Vierten Weges sehr wohl – schon immer und auch tiefer – genau diese Transformationsarbeit betreiben, freier von unseren weitgehend mechanischen Mustern zu werden.) Getoppt wird das «Alleinstellungsmerkmal» des DEZ (und dieses Projekts) mit dem «klaren Statement», dass «wir die Einzigen sind, die bedingungslos an die tiefe Wahrheit der Enneagramm-Idee glauben … die meisten andern ‘Schulen’ kombinieren es mit dem, was sie mitgebracht haben. Und dadurch wird die Schönheit beeinträchtigt.» (S. 570f). Abgesehen davon, dass Reifarth und sein DEZ das Enneagramm sehr wohl mit Anderem verbinden, mit Martin Bubers Philosophie sozusagen verschmelzen (wogegen nichts zu sagen ist!), beginnt man sich im Lauf des Buchs zu fragen: Weshalb diese Selbstbeweihräucherung, meist verbunden mit – oft pauschaler, d.h. nicht qualifizierter – Abwertung von Anderem und Anderen? Sie erschliesst sich mir lediglich mit Reifarths Enneagrammtyp und seiner Auffassung der Leidenschaft, indem er auch in diesem Buch einige Male darauf hinweist, wie stolz er auf seinen Stolz ist.
Nachwort für LeserInnen des EnneaForums
Obschon diese Einschlüsse die Substanz überschatten: Wilfried Reifarths Projekt Enneavision ist eine Pioniertat in der Enneagrammlandschaft. Dafür und für den Aufwand, uns dies zugänglich zu machen, mein Respekt und Dank! Die EntwicklungsArbeit läuft als Thema in diesem Projekt zwar mit, jedoch nicht als Hauptthema. Für diese gibt es in der Enneagrammlandschaft jedoch Ansätze, welche der Anwendung der Enneagramm-Idee mindestens Ebenbürtiges, sogar Radikaleres abgewinnen, z.B. die Transformation der Leidenschaft sogar als Kerngeschäft betreiben. Es macht einen grossen Unterschied, ob man die Enneamuster nur auf einer psychologischen Ebene betrachtet (und berät): Hier geht es darum, sie zu optimieren, durchaus mit Entwicklungspotenzial (Persönlichkeitsentwicklung). Aus spiritueller Sicht sind die neun Muster Überlebensstrategien, denen wir zwar viel zu verdanken haben, uns jedoch später – zu weitgehend unbewussten Gewohnheiten geronnen – mehr im Weg stehen. Enneagrammschulen des Vierten Weges haben sich deshalb die Des-Identifikation von unseren Mustern auf die Fahne geschrieben: Die Muster jedes Enneatyps sind nicht an sich schlecht, das Problem sind ihre Automatismen: dass sie aus uns «Maschinen» gemacht haben, die entlang ihrer aus diesen Überlebensstrategien heraus kristallisierten Gewohnheiten in einem Zustand «unbewussten Schlafs» unfrei durchs Leben gehen, um Gurdjieff als Urvater des Enneagramms zu zitieren (zu dem Reifarth ja 2013 ein eigenes Buch verfasst hat). Diese spirituelle Perspektive ist eine tiefe Beleidigung unseres Egos. Sie führt jedoch aus unseren Gefängnissen heraus ans Licht, in die Freiheit und in ein wahres Leben jenseits unserer Muster, das uns unbekannt bleibt, solange wir an ihnen festhalten. Wilfried Reifarths neues Buch ist diese umfangreich gewordene Besprechung wert. Ich schliesse mit einem Denkanstoss, der mir bei der 550-seitigen Lektüre der vielen Stimmen im O-Ton aus den neun Kammern des Enneagramms in den Sinn gekommen ist, und für mich den Kern der Transformationsarbeit mit dem Enneagramm ausdrückt, freier von der Mechanik unserer Muster zu werden: «Wir alle versuchen, geboren zu werden, bevor wir sterben.» (Stephen Levine). Auch eine Enneavision!
23. April 2025 / Samuel Jakob
www.enneagramm.ch
Wilfried Reifarth
Enneavision. Passgenaue Beratung und EntwicklungsArbeit mit dem Enneagramm.
Verlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Berlin 2025. 584 S., 29€.